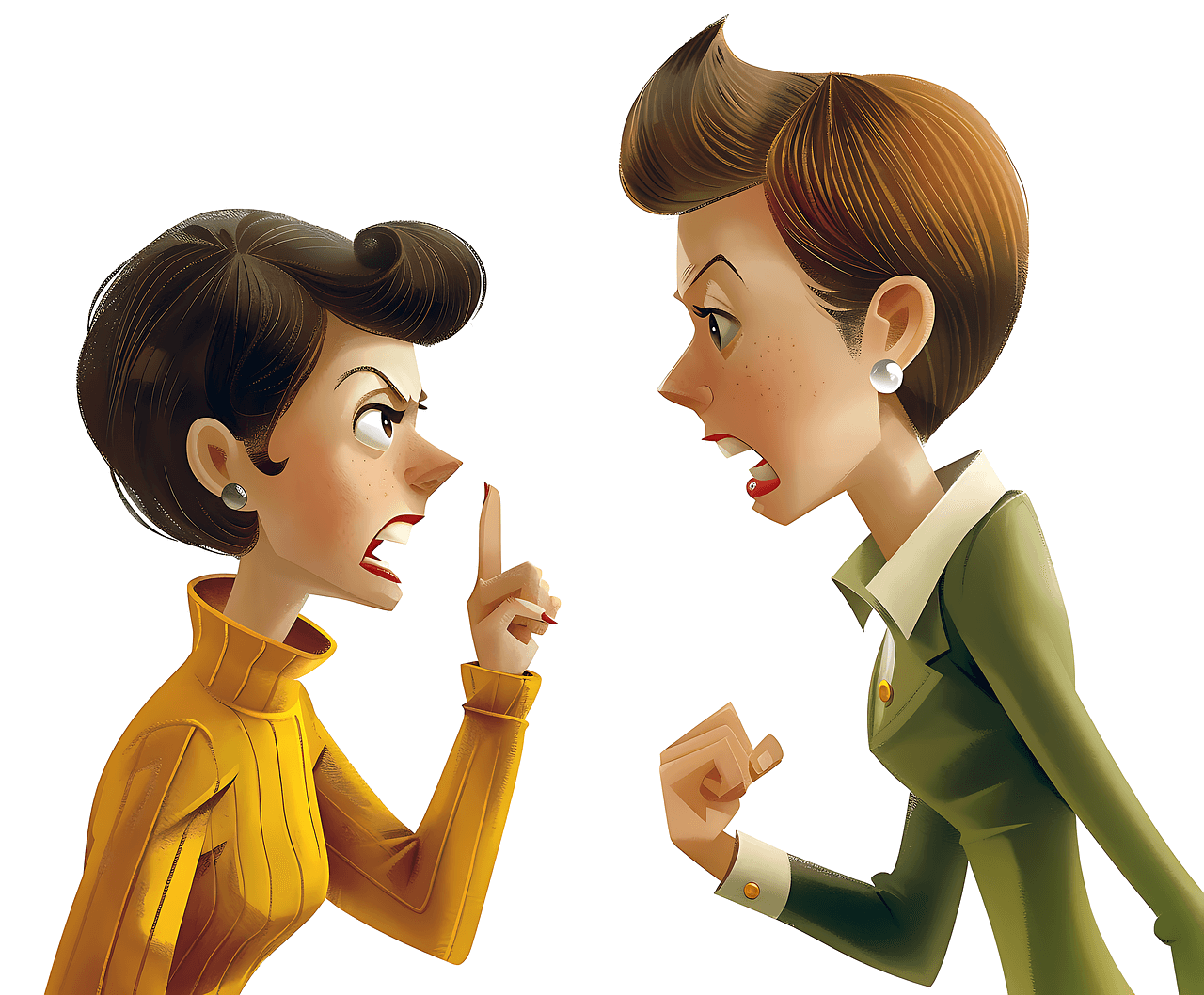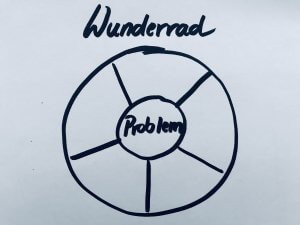Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Lösung Ihres Konflikts
Lesezeit: 5 Minuten
Konflikte am Arbeitsplatz sind vorprogrammiert. Oft scheint die „Arbeit-)Welt an einem Tag noch in Ordnung und am nächsten Tag befindet man sich mitten in einem Konflikt. Man wundert sich, wie das so schnell gehen konnte und wie es überhaupt so weit kam.
Der österreichische Konfliktforscher Friedrich Glasl hat ein Modell entwickelt, das den Verlauf von Konflikten in neun Eskalationsstufen unterteilt. Diese Stufen helfen zu verstehen, wie Konflikte eskalieren und wann sie noch intern gelöst werden können. Er sagt, dass in den ersten drei Konfliktstufen die Konfliktparteien die Situation noch alleine bzw. mit einer vertrauten Person ohne Zuziehung von externen Expertinnen lösen können.
In dieser Anfangsphase des Konflikts, der Verhärtung, entstehen erste Meinungsverschiedenheiten, die jedoch noch keine größere Bedrohung darstellen. Die Konfliktparteien sind sich der Differenzen bewusst, aber die Kommunikation ist noch offen und konstruktiv. In dieser Phase kann der Konflikt durch direkte Kommunikation und ein klärendes Gespräch leicht gelöst werden.
Der Konflikt verschärft sich in Stufe 2, der Polarisierung und Debatte, und die Meinungsverschiedenheiten werden deutlicher. Jede Partei beginnt, ihre Position zu verteidigen und die Gegenseite als Gegner:in zu betrachten. Es kommt vermehrt zu emotionalen Auseinandersetzungen, und die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation steigt. Auch in dieser Phase kann eine Vermittlung durch eine neutrale Person, wie eine Führungskraft oder ein Mediator, helfen, den Konflikt intern zu lösen.
In der dritten Phase der Taten statt Worte treten die verbalen Auseinandersetzungen in den Hintergrund, und es folgen Handlungen. Die Konfliktparteien beginnen, die Position des anderen aktiv zu sabotieren oder zu untergraben. Hier wird es zunehmend schwieriger, den Konflikt ohne externe Hilfe zu lösen. Es besteht jedoch noch die Möglichkeit, durch intensive Mediation oder Schlichtung einzugreifen, bevor der Konflikt weiter eskaliert.
Ab Stufe 4 (Images und Koalitionen) ist der Konflikt so weit eskaliert, dass eine interne Lösung äußerst schwierig wird. In diesen Phasen kann es notwendig sein, externe Expert:innen oder Mediator:innen beizuziehen, um den Konflikt zu entschärfen.
Vorgehensweise der Konfliktlösung
So können Sie vorgehen, um einen Konflikt, in dem Sie selbst selbst involviert sind, zu lösen:
Schritt 1: Selbstreflexion und Vorbereitung
Bevor Sie den Konflikt ansprechen, ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren.
- Identifizieren Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse: Was genau stört mich? Welche Gefühle löst der Konflikt in mir aus? Was brauche ich, um den Konflikt zu lösen?
- Überlegen Sie sich Ihr Ziel: Was möchte ich durch das Gespräch erreichen? Geht es mir darum, das Problem zu lösen, eine Entschuldigung zu erhalten oder das Arbeitsverhältnis zu verbessern?
- Erkennen Sie Ihre eigene Rolle: Reflektieren Sie ehrlich über Ihren eigenen Anteil am Konflikt. Habe ich vielleicht durch mein Verhalten oder meine Worte den Konflikt verschärft?
Schritt 2: Den richtigen Zeitpunkt und Ort wählen
Der Erfolg eines Konfliktgesprächs hängt stark von den äußeren Umständen ab.
- Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt: Suchen Sie nach einem Moment, in dem beide Parteien ruhig und nicht unter Zeitdruck sind.
- Finden Sie einen neutralen Ort: Der Ort des Gesprächs sollte neutral sein, also weder der Arbeitsplatz noch ein Raum, in dem sich eine Partei besonders „zu Hause“ fühlt. Das Gespräch sollte auch nicht „zwischen Tür und Angel“ stattfinden. Ein ruhiges Büro oder ein Meetingraum kann ideal sein.
Schritt 3: Das Gespräch initiieren
Gehen Sie proaktiv auf die andere Person zu, um das Gespräch zu beginnen.
- Sprechen Sie die Person direkt an: Beginnen Sie das Gespräch freundlich, z.B. „Ich würde gerne über etwas sprechen, das mir auf dem Herzen liegt. Hast du kurz Zeit?“
- Vermeiden Sie Vorwürfe: Formulieren Sie Ihr Anliegen in „Ich-Botschaften“ statt „Du-Botschaften“, z.B. „Ich habe das Gefühl, dass…“ statt „Du machst immer…“.
Schritt 4: Das Problem benennen und Perspektiven austauschen
Im Hauptteil des Gesprächs geht es darum, das Problem klar zu benennen und die Sichtweisen auszutauschen.
- Beschreiben Sie das Problem sachlich: Erklären Sie, was Sie stört, ohne die andere Person anzugreifen. Zum Beispiel: „Mir ist aufgefallen, dass wir in letzter Zeit öfter Missverständnisse haben, die unsere Zusammenarbeit erschweren.“
- Hören Sie aktiv zu: Geben Sie der anderen Person die Gelegenheit, ihre Sichtweise darzulegen. Hören Sie aufmerksam zu, unterbrechen Sie nicht und zeigen Sie Verständnis, auch wenn Sie nicht zustimmen.
- Vermeiden Sie Eskalation: Wenn die Emotionen hochkochen, bleiben Sie ruhig und sachlich. Es kann hilfreich sein, eine kurze Pause einzulegen, um die Situation zu beruhigen.
Schritt 5: Gemeinsam Lösungen entwickeln
Nachdem beide Seiten ihre Perspektiven ausgetauscht haben, geht es darum, Lösungen zu finden.
- Fokussieren Sie sich auf das gemeinsame Ziel: Arbeiten Sie zusammen darauf hin, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist. Frage z.B. „Was könnten wir tun, um in Zukunft besser zusammenzuarbeiten?“
- Seien Sie offen für Kompromisse: Seien Sie bereit, Kompromisse einzugehen, wenn es nötig ist. Eine Lösung muss nicht perfekt sein, sondern für beide Seiten akzeptabel.
Schritt 6: Vereinbarungen treffen
Sobald eine Lösung gefunden ist, sollte diese klar festgehalten werden.
- Klare Absprachen treffen: Definieren Sie, wer was tun wird und bis wann. Beispielsweise: „Wir vereinbaren, dass wir uns künftig einmal pro Woche kurz absprechen, um Missverständnisse zu vermeiden.“
- Verbindlichkeit schaffen: Bestätigen Sie die getroffene Vereinbarung und stellen Sie sicher, dass beide Seiten sich daran halten werden.
Schritt 7: Nachverfolgen und Feedback geben
Ein einmaliges Gespräch reicht oft nicht aus, um einen Konflikt nachhaltig zu lösen.
- Überprüfen Sie die Umsetzung: Nach einer angemessenen Zeitspanne (z.B. nach ein bis zwei Wochen) sollten Sie überprüfen, ob die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt wurden und ob sie wirken.
- Feedback einholen: Fragen Sie die andere Person, wie sie die aktuelle Situation einschätzt, und geben Sie auch selbst Rückmeldung, ob Sie eine Verbesserung bemerkt haben.
Schritt 8: Falls nötig, externe Hilfe einholen
Wenn der Konflikt trotz aller Bemühungen nicht gelöst wird, kann es sinnvoll sein, externe Unterstützung hinzuzuziehen.
- Mediation: Eine neutrale dritte Person, wie ein:e Mediator:in oder eine Führungskraft, kann helfen, den Konflikt zu moderieren und eine Lösung zu finden.
- Weiterführende Maßnahmen: In schwerwiegenden Fällen könnte es notwendig sein, die Personalabteilung oder andere offizielle Stellen einzuschalten.